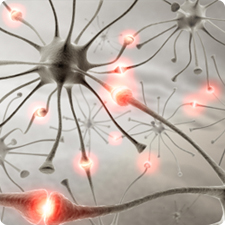
VON CLEMENS POKORNY | 02.04.2012 10:25
Vertrauen – eine Frage der Biochemie?
Das Hormon Oxytocin ist entscheidend daran beteiligt, wenn wir Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen. Das kann für die Behandlung autistischer Menschen wichtig sein. Für Gesunde gilt aber: Vertrauen entsteht nicht durch ein Hormon, sondern durch Erfahrung und Einfühlungsvermögen
Im Jahr 2005 machte ein Bericht der naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift „Nature“ Schlagzeilen: Forscher hatten erstmals nachgewiesen, dass das Hormon Oxytocin entscheidend dafür verantwortlich ist, ob wir anderen Menschen vertrauen oder nicht. Probanden eines Experiments zeigten sich signifikant vertrauensseliger, wenn sie zuvor gasförmiges Oxytocin inhaliert hatten.
Dieser Botenstoff ist Biochemikern schon seit 1953 bekannt. In hoher Konzentration wird es v.a. von Frauen für eine leichtere Geburt ausgeschüttet (daher der griechische Name: okys – schnell und tiktein – gebären). Aber Oxytocin steuert über die Amygadala im Limbischen System auch Partnerbindung, Liebe („Kuschelhormon“), mütterliches Pflegeverhalten – beim Stillen produziert die Mutter besonders viel Oxytocin gegen den damit verbundenen Stress –, Sex („Orgasmushormon“), das soziale Gedächtnis und Angst. So sorgt Oxytocin unter anderem dafür, dass wir beispielsweise Gesichtern, die wir eigentlich als wenig vertrauenserweckend einstufen, dennoch Vertrauen schenken. Deshalb wird es bereits als mögliches Therapeutikum für Autisten diskutiert.
Erstmals gelang der Nachweis eines Zusammenhangs zwischen Oxytocinausschüttung und Vertrauen in einem ökonomischen Experiment. Die eine Hälfte der Probanden inhalierte zu Beginn Oxytocin durch die Nase, die Kontrollgruppe ein Placebo. Dann folgte ein Investitionsspiel: Paare bekamen jeweils eine Anfangsausstattung von 12 Punkten. Der erste Spieler gab dem zweiten – von dem er nicht wusste, wer es war – einen frei bemessenen Teil dieses Spielgeldes, „investierte“ sozusagen in ihn. Die investierte Summe wurde vom Spielleiter verdreifacht. Der zweite Spieler konnte nun abwägen, ob und wie viel er seinem Geldgeber zurückgab. Der erste Teilnehmer musste sich also fragen, wie viel Vertrauen er in die Vertrauenswürdigkeit des zweiten, ihm unbekannten setzt. Das Ergebnis: Unter Gabe von Oxytocin waren mehr als doppelt so viele Probanden bereit, ihrem Geschäftspartner ihre gesamten zwölf Punkte als Kredit zu leihen und somit auch ein maximales Risiko einzugehen.
Der US-amerikanische Neuroökonom Paul Zag meint darüber hinaus, dass die Oxytocin-Konzentration in unserem Körper sogar darüber entscheidet, wie moralisch wir handeln. Als Belege dafür führt er seine Untersuchungen an, in denen eine erhöhte Spendenbereitschaft nach dem Inhalieren von Oxytocin beobachtet wurde, und umgekehrt ein Experiment, in dem ein erhöhter Oxytocinspiegel nach dem Betrachten eines mitleiderregenden Kurzfilms gemessen wurde. Mitgefühl oder die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ist aber eine zentrale Voraussetzung für moralisches Handeln. Menschen mit einem zu niedrigen Oxytocinspiegel wie zum Beispiel Missbrauchsopfer oder Gestresste zeigen entsprechend seltener mitfühlendes Verhalten.
Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen unter einigermaßen entspannten Bedingungen moralischer agieren – keine Überraschung – und dass in Situationen, in denen unsere Empathie gefragt ist, das Hormon Oxytocin die für die emotionale Beurteilung von Situationen zuständige Amygdala so beeinflusst, dass man vertrauensseliger wird. Rational ungerechtfertigtes Vertrauen kann unser Gehirn daher weder alleine erzeugen noch etwa unter Einfluss von heimlich zugeführtem Oxytocin. Denn wer würde es nicht bemerken, wenn ihm jemand gewaltsam ein Gas in die Nase sprayen würde? Somit bleibt Vertrauen eine Frage der Erfahrung und der Empathie – die Biochemie sagt uns nur, was in unserem Gehirn abläuft, wenn wir Anderen vertrauen.
