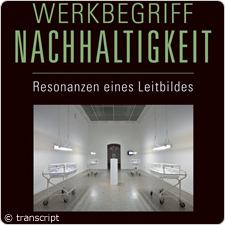VON JOACHIM SCHEUERER | 08.01.2014 17:03
„Werkbegriff Nachhaltigkeit“ - ein inspirierender Lagebericht zum Paradigma der Stunde
Vor gut zwei Wochen entging der UN-Klimagipfel gerade noch einem kompletten Scheitern, doch Grund zum Optimismus gab er auch nicht, obgleich es mittlerweile eigentlich alle begriffen haben müssten, dass der Klimawandel keine bloße Ansichtssache mehr ist. Lediglich im Detail gibt es unterschiedliche Szenarien und Entwicklungsmöglichkeiten, die, wie der zum Teil umstrittene aktuelle UNO-Klimabericht zeigt, nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit vorherzusagen sind. Zu zahlreich sind die verschiedenen, teilweise nicht erschöpfend messbaren Faktoren, die beim Klimawandel eine Rolle spielen (können). Dementsprechend lässt auch Jorgen Randers in seinem neuen Folgebericht zum epochemachenden Werk die „Grenzen des Wachstums“ des „Club of Rome“ differente Ergebnisse und Forschermeinungen nebeneinander stehen, um das mögliche klimatische und soziale Problemspektrum der kommenden 40 Jahre auszuloten.
Einen ähnlich bescheidenen Ansatz verfolgt der vorliegende Band „Werkbegriff Nachhaltigkeit“ von Kai Mitschele und Sabine Scharff, welcher versucht, sich dem Zeitgeist bestimmenden Begriff der „Nachhaltigkeit“ aus verschiedenen Richtungen und Disziplinen zu nähern, um seine vermeintlich unübersichtlichen und oftmals verwässerten Erscheinungs- und Verwendungsweisen besser einordnen zu können. Dabei eröffnen Sie ein äußerst produktives Begriffs-Panorama, welches der Prozesshaftigkeit, Mehrdimensionalität und Pluralität an Deutungen des Nachhaltigkeitskonzepts Rechnung trägt.
Niko Peach und seine Postwachstumsökonomie
Peach gilt als Deutschlands radikalster Wachstumskritiker. Wirtschaftswachstum aller Art, selbst in Bereichen der "Nachhaltigkeit", führen früher oder später nur zum wirtschaftlichen Kollaps, so seine These
[...]»
Den Ausgangspunkt dieser Anthologie bildet der im 20. Jahrhundert, im Zuge des durch die Raumfahrt ermöglichten Perspektivenwechsels, gereiften Mythos von der Erde als schöner, einzigartiger und fragiler „blue marble“. Die Wurzeln dieser Reifung sind jedoch weitaus älter als oftmals angenommen. So verfolgt der Germanist Ulrich Grober in seinem Beitrag die begrifflichen Ursprünge der Nachhaltigkeit bis zurück zu den vedischen Gesängen, den Texten Franz von Assisis und dem Armutsideal der Franziskaner, sowie zur christlichen Schöpfungslehre und zum Glauben an die göttliche Vorsehung. Als weitere Wegbereiter unseres modernen Nachhaltigkeitsdiskurses werden zudem René Descartes, Spinoza und insbesondere der Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz beleuchtet, dessen Buch „Sylvicultura oeconomica“ aus dem Jahre 1713 erstmals den Begriff der Nachhaltigkeit samt seiner heute immer noch gültigen
dreigliedrigen Struktur aus Ökonomie, Ökologie und sozialer Ethik schriftlich fixiert hat. Über die Arbeiten Carl Nilsson Linnés im 18. Jahrhundert und Ernst Haeckels Einführung des Terminus der „Oecologie“ im 19. Jahrhundert gelangt das Nachhaltigkeitsparadigma daraufhin dann allmählich ins 20. Jahrhundert, wo die Ikonisierung der „blauen Murmel“ letztlich in die Brundtland-Formel der UNO von 1987 mündet.
Äußerst erhellend ist auch der Beitrag des Philosophen und Politikwissenschaftlers Wolf Dieter Enkelmann, in dem er mögliche Verdrängungsimpulse hinter dem keynesianischen Streben nach Profitmaximierung diskutiert, welches die nackte Wahrheit der Unausweichlichkeit des Todes mithilfe unendlicher Reproduktion zu verdecken versucht. Nach einer Skizze der kühnen, transhumanen Visionen der Technikoptimisten unserer Zeit nimmt Enkelmann dann den Nachhaltigkeits-Begriff Carlowitzer Prägung kritisch unter die Lupe, um aufzuzeigen inwiefern jener (implizit) immer noch an alte ökonomische Denkkategorien wie Nutzen, Profit, Reproduktion, Besitz und Habe geknüpft ist. Für ihn besteht die Möglichkeit, dass unser gedanklicher Horizont dessen, was Nachhaltigkeit ist und sein soll, eigentlich noch in Kinderschuhen steckt.
Die enge Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Ökonomie ist auch Gegenstand des Beitrags der Medienkünstlerin und Kulturphilosophin Yana Milev, in dem sie versucht zu zeigen, inwiefern sich die kapitalistische Ideologie den Nachhaltigkeitstrend zunutze macht, um das Überleben des Wachstumsparadigmas im neuen Gewand zu sichern. Dagegen gibt Milev ein neues produktiveres und chancenorientiertes Verständnis von Krise zu bedenken, welches ihrer Meinung nach helfen könnte künstlich erzeugte Wohlstandsgefälle zwischen Arm und Reich abzubauen. Dabei stellt sie verschiedene Deutungsmöglichkeiten von Krise vor, sowie die Gründe und Nutznießer einer negativen Konnotation von Krise. Ebenso anregend und inspirierend sind auch die anderen Beiträge zur Bedeutung und Integration der Nachhaltigkeit im Bereich des Designs, der Architektur oder bei der Energiewende. Ulrich Grober fordert in seinem Text Mut und Weisheit im Umgang mit der Natur. Dieses Buch macht Mut und weiser und das ganz ohne plumpes Moralisieren.
Mitschele, Kai u. Scharff, Sabine: „Werkbegriff Nachhaltigkeit“
transcript Verlag, Bielefeld, 2013. 217 S.
ISBN 978-3-8376-2422-9.
-
Franz Kafkas "Der Prozess" und das Problem der sich "selbst erfüllenden Prophezeiung"
Wenige Romane besitzen eine solche Strahlkraft wie Franz Kafkas „Der Proceß“, was nicht zuletzt mit seiner schieren Uninterpretierbarkeit oder besser seiner schier unendlichen Interpretierbarkeit zusammen hängt. Nicht umsonst warnte Detlef Kremer vor der Spiegelhaftigkeit dieses Werkes, welches „genau jene Bildinhalte getreu, aber teilnahmslos zurückwirft, die man ihm anbietet“, weshalb vom Interpreten ein hohes Maß an „skeptischer Selbstdistanz“ sowie das Wissen um die „zeitliche Relativität“ der Textauslegung gefordert sei (Kremer, 1989). Genau hierin liegt jedoch auch die große Langlebigkeit dieses Romans begründet. Es scheint fast so, als hätte Kafka es geschafft eine menschliche Grundstruktur einzufangen, mit deren Hilfe man die unterschiedlichsten Zeitkontexte erfassen und reflektieren kann. So ist vor allem auch der darin verwobene Konflikt zwischen Emanzipation und Assimilation, Selbstbejahung und Selbstverneinung, sowie die Angst vor der eigenen Freiheit und der damit einhergehenden Verantwortung für sich selbst, wie eine Symptombeschreibung unserer heutigen Zeit und macht dieses Buch fast schon zur Pflichtlektüre für jeden, der seine „selbst verschuldete“ und sich wieder und wieder selbst erfüllende Unmündigkeit durchbrechen möchte.
[...]»
-
Mission: Müll – Aus alt mach neu. TerraCycle will den Müll abschaffen.
TerraCycle hat eine Mission: Abfall abschaffen. Klingt gut, ist es auch. Das US-amerikanische Unternehmen macht aus Dingen, die nicht mehr recycelt werden können, Nützliches und Schönes. Egal ob Verpackungsmaterial, Klobrillen oder alte Uhren, TerraCycle hat für alles eine Idee. Ob das Zukunft hat?
UNI.DE möchte das herausfinden und hat sich das Unternehmen mal genauer angeschaut. Die Geschäftsidee von Tom Szaky ist so simpel wie einfach: Vor knapp 80 Jahren gab es nur einen Bruchteil soviel Müll wie heute. Der 28-jährige glaubt, dass die heutige Konsumgesellschaft daran schuld sei. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Denn in den USA können nur wenige Verpackungsmaterialien recycelt werden.
[...]»
-
Kümmert scheinbar keinen: die Folgen von Luftverschmutzung auf den Menschen
Der Skandal um die Dieselmotoren von VW hat gezeigt: Man umgeht Abgasrichtlinien so gut es geht, im Zweifelsfall setzt man sich auch über sie hinweg. Dass aber Luftverschmutzung vor allem schädigende Wirkung auf den Menschen hat, wurde bislang oft vernachlässigt. Nun hat der Internationale Währungsfonds ein Arbeitspapier herausgebracht, das Subventionen fossiler Energieträger mit den Schäden für Umwelt und für den Menschen verknüpft. Diese Subventionen werden so zu den Hauptverursachern von Krankheiten durch Luftverschmutzung. Was dagegen getan werden muss und was die Erkrankungen durch Luftverschmutzung kosten, hat UNI.DE hier zusammengetragen.
[...]»
-
Das Licht der Zukunft: Wie nachhaltig sind unsere Leuchtmittel?
Seit Inkrafttreten der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG der EU im September 2009 ist die Frage um die Nachhaltigkeit unserer Lichtquellen immer relevanter geworden. Durch diese Richtlinie sollte aus Umweltschutzgründen die Herstellung von Glühlampen schrittweise verboten werden. Verbraucher müssen sich nun nach einem Ersatz zur Glühbirne umsehen. Doch wie effizient und nachhaltig sind diese alternativen Leuchtmittel? UNI.de hat sich umgesehen.
[...]»
-
Das Auto der Zukunft
Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge: Die individuelle Mobilität erfährt derzeit einen wahrhaft radikalen Wandel – denn dieser betrifft, neben der Sicherheit der Fahrzeuginsassen, vor allem den Antrieb
[...]»
-
Die Remakery. Von altem Zeug und neuen Menschen
Kaputte Kacheln, alte Holzbretter, Gerüststangen oder auch Bodenbeläge für Turnhallen: All diese Sachen werden in Brixton, im Süden von London, benutzt, um aus ihnen wieder etwas neues herzustellen. Die
Remakery heisst das Zentrum, in dem die unterschiedlichsten Materialien, die sonst auf der Müllhalde landen, wieder verwertet werden. All diese kleinen Werkstätten und ihre Projekte basieren auf ehrenamtlicher Arbeit, wodurch vor allem sozial Benachteiligte wieder sozialisiert und in die Gemeinschaft eingegliedert werden sollen.
[...]»
-
Alternativen gegen den Welthunger
Gegrillte Termiten, frittierte Grillen: Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) glaubt, in den kleinen Insekten eine Wunderwaffe gegen den Welthunger gefunden zu haben. Was hierzulande eher Irritation und Ekel auslöst, ist in vielen Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas so gar nichts neues. Etwa 1000 verschiedene Insektenarten sind für den Verzehr geeignet und besonders reich an Vitaminen und Proteinen, doch ist dies wirklich die ultimative Lösung, um den Hunger auf der Erde zu bekämpfen?
[...]»
-
Info-Ladys von Bangladesch
Über 150 Millionen Menschen leben in Bangladesch, gerade in den ländlichen Regionen haben vielen von Ihnen keinen Zugang zum Internet. Es gibt aber eine Gruppe von Frauen, die Abhilfe schaffen und sie tun noch mehr. Die Info-Ladys von Bangladesch helfen nicht nur Mädchen und jungen Frauen, sondern auch Schülern und Menschen, die fernab jeglicher Kommunikationsmöglichkeiten wohnen. Sie fahren in abgelegene Dörfer und zeigen den Einwohnern, wie sie mit einem Laptop umgehen, sie helfen Schülern, sich online für die Oberschule anzumelden und beraten Mädchen in den sonst so verpönten Fragen wie Aids, Verhütung und Monatshygiene.
[...]»
-
Pestizide: Ein notwendiges Übel?
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden synthetische Pflanzenschutzmittel zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft eingesetzt. Doch Pestizide sind nicht alternativlos.
[...]»
-
Mosambik im Rausch der Rohstoffe – Gold, Erdgas und ein armes Land
In den vergangenen Jahren wurden im afrikanischen Staat Mosambik reiche Vorkommen an Gold und Erdgas entdeckt. Nun hofft die arme Bevölkerung, von der Förderung zu profitieren und tatsächlich wächst die Wirtschaft stark an. Experten vermuten jedoch, dass von den Einnahmen nicht viel bei der Bevölkerung ankommen wird. Gutbezahlte Jobs werden vermehrt an Personal aus dem Ausland vergeben, währenddessen fürchten Kritiker, dass die korrupte Regierung des Landes sich selbst die Taschen füllt. Was bringen die Rohstoffe dem Land wirklich?
[...]»