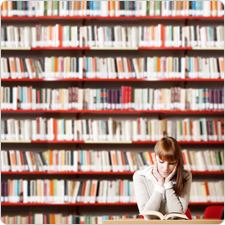
VON SINEM S. | 18.04.2013 16:43
Der Hochschulpakt
Bis zum Jahr 2015 sollen Bund und Länder den Hochschulpakt, der 2007 beschlossen wurde, um einen weiteren Millionenbetrag aufstocken. Allein der Bund wird den Ausbau der Hochschulen mit weiteren 2,2 Milliarden Euro finanzieren, so die Einigung der Wissenschaftsminister von Bund und Ländern im April 2013 in Berlin. Damit die Fachkräfte in Deutschland in einigen Jahren nicht fehlen, müssen nun viele Studierende auf ihrem Weg in die Berufswelt unterstützt werden. Ob Ausbau der Mensen, Wohnheime oder Bibliotheken, an Geld mangelt es derzeit überall, die Hörsäle sind überfüllt und die Master-Studienplätze rar. Dies soll der Hochschulpakt nun verbessern.
Bereits zum zweiten Mal werden die Mittel für den Hochschulpakt durch Bund und Länder nun erhöht. In der ersten Phase des Hochschulpaktes (von 2007 bis 2010) gelang es den Ländern noch nicht so ganz, die steigenden Ausgaben trotz Finanzspritze durch den Bund aufzufangen. Manche Länder, wie Berlin, Hamburg und Bremen blieben dem Bund sogar ihren ersten Anteil schuldig, denn die Länder hatten sich im Rahmen dieses Hochschulpaktes verpflichtet, beidseitig den Ausbau des Bildungssektors zu finanzieren.
Bildung in der Krise?
Die europäische Schuldenkrise bedroht die Universitäten. Die betroffenen Länder sparen oftmals gerade in dem Bereich, der für ihre langfristige wirtschaftliche Entwicklung zentral ist
[...]»
Qualitätsoffensive Lehrerbildung
Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) hat ebenfalls im April 2013 die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ beschlossen. Ab 2014 sollen Bund und Länder bis 2024 mit bis zu 500 Millionen Euro unterstützt werden, um die Qualität des Lehramtsstudiums zu verbessern. Auch das Stichwort Mobilität stand auf der Tagesordnung, denn zukünftig soll der Wechsel von einem Bundesland ins nächste für Lehramtsanwärter einfacher gestaltet werden. Zusätzlich wird die Universitätsmedizin weiter ausgebaut werden, denn an den Universitätskliniken fehlt jetzt schon das Geld, um Forschung und Lehre voranzutreiben. Allerdings bedeutet ein Studienplatz mehr nicht unbedingt mehr Platz in den Mensen der Universitäten oder mehr Wohnheimzimmer. Hier besteht ebenfalls dringender Handlungsbedarf, denn der Mangel an Unterkünften erschwert die Studien- und Arbeitsbedingungen der Studenten erheblich. Die von Bildungsministerin Wanka geplante BAföG-Reform lässt ebenfalls noch auf sich warten, ursprünglich war von einer Erhöhung des BAföG-Satzes die Rede, zudem sollte berufserfahrenen Studieninteressierten durch eine Anhebung der BAföG-Altersgrenze der Zugang zum Hochschulstudium erleichtert werden.
