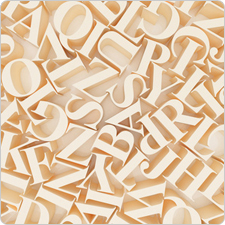
VON JULIA ZETZ | 09.09.2013 13:04
Wahlkampf oder: Wie man mit schönen Worten wenig ausdrückt
Neulich in der Mittagspause: Ein Wahlkampfplakat, eines von tausenden in der Stadt. Eines mit schönen Worten, ohne jeden Zusammenhang. Da hing es, unschuldig an einem Grünstreifen und wurde Opfer einer gemeinen Urin-Attacke eines wahlfaulen Schäferhundes. Ob der treue Wegbegleiter nur die Meinung seines Herrchens wiedergeben wollte bleibt an dieser Stelle offen. Aber auch das ist Wahlkampf und der läuft schon seit Monaten. Alle vier Jahre, einige Monate vor der Bundestagswahl, geht er los, der Kampf um die Wählerstimmen. Und als ob es nicht genug wäre, die Städte mit bunten Plakaten zu pflastern, übertrugen gleichzeitig vier TV-Sender das diesjährige Kanzlerduell. Obwohl Stefan Raab in die prüde Veranstaltung mit gewollter Flapsigkeit etwas Schwung brachte, stellt sich eine Frage: Sollte Wahlkampf derart penetrant sein? Warum erfahren wir nicht eine ganze Legislaturperiode lang was und warum unsere Politiker etwas für unsere Wünsche tun?
Warum gibt es eigentlich keine AdBlocker für das richtige Leben? Im Netz können wir uns vor ungewollter Werbung mit einem kleinen Programm schützen, praktisch wäre das auch für den Weg in die Arbeit oder den Stadtbummel. Viele sind sich einig: Noch nie waren Wahlplakate so inhaltsleer wie in der Vorwahlphase 2013. Die Piraten fordern: „Leb so wie du bist“. Muss man nun als Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebes auf der Müllkippe leben? Die FDP erfindet die Welt ganz neu und stellt fest: „Gelb ist einfach heller als schwarz“. Nun, Grün ist auch grüner als Gelb, oder? Und die CSU sagt einfach nichts und lässt Karl Freller für sich sprechen. Hat die bayerische Partei bereits ihr verbales Pulver verschossen?
Die Macht der Werbung
Jenseits individueller Konsumentscheidungen erstreckt sich die Macht der Werbung bis in die politische Meinungsbildung – eine Untergrabung der Demokratie?
[...]»
Am Abend des Kanzlerduells gab es eine neue Sensation, die Deutschlandkette. Innerhalb weniger Stunden hatte der Twitter-Account @schlandkette mehrere tausend Follower, bis heute sind es über 8.000. Zum Vergleich: Renate Künast, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, hat nur knapp 4.500 Verfolger bei Twitter. Offenbar haben wir mehr Interesse an einem modischen Accessoire als an deiner politischen Debatte.
Und genauso starr wie das TV-Duell der vergangen Woche ist auch der politische Wahlkampf. Leere Floskeln und nichtssagende Plakate bestimmen das derzeitige politische Geschehen. Warum gibt es keinen politischen Kummerkasten, der die Fragen und Wünsche derer, die letztlich ihr Kreuz auf einem Stimmzettel abgeben, beantwortet? Wo ist denn die volksnahe Politik geblieben? Offensichtlich ist sie irgendwo zwischen Wahlkampfveranstaltung und Plakatdruck verloren gegangen.
Mit den letzten Mitteln
Augenscheinlich haben auch die Parteien im Bundestag gemerkt, dass sie sich mehr von den Wählern entfernen, als ihnen entgegen zu kommen. Warum dann nicht ein bisschen kommerziell werden und zeigen, dass man auch cool sein kann. Bei CDU und SPD ging der Schuss nach hinten los, denn die Düsseldorfer Punkband „Die Toten Hosen“ wehrte sich öffentlich dagegen, durch ihren Song „Tage wie diese“, der auf Wahlkampfveranstaltungen gespielt wurde, mit politischen Statements in Verbindung gebracht zu werden.
Und wer sich dennoch dem Kampf um die eigene Wählerstimme nicht entziehen kann, dem bleibt nur ein Licht am Horizont: am 22. September ist alles vorbei.
